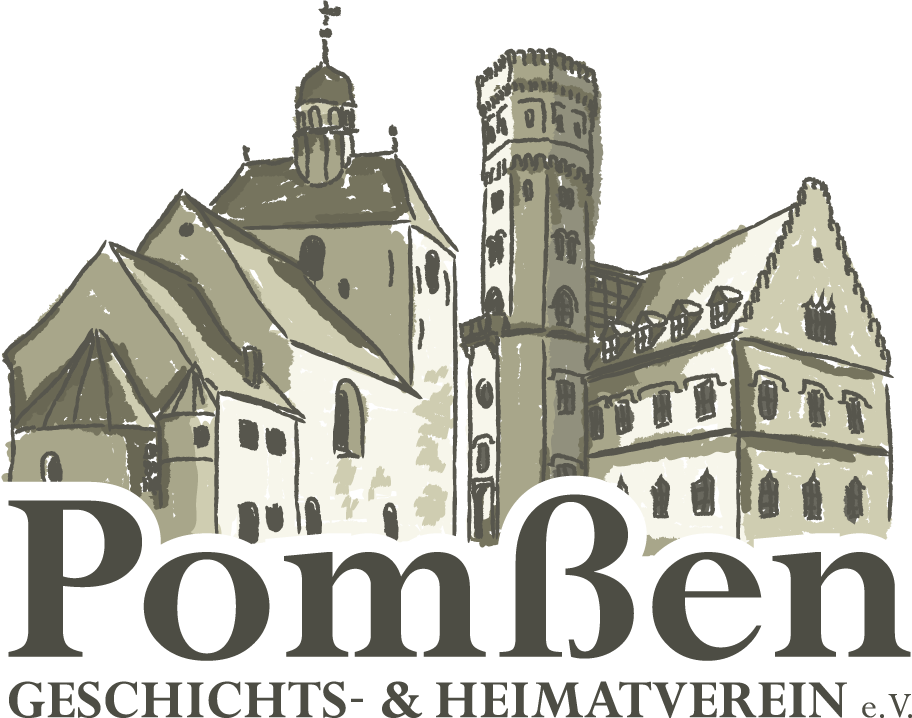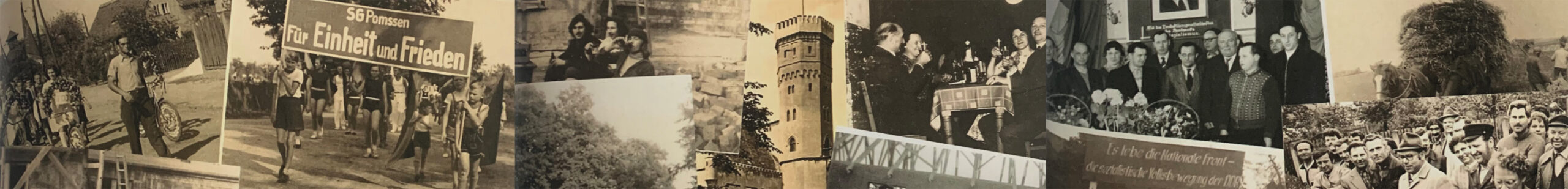Chronologischer Überblick über Ereignisse in Pomßen bis 1990
zusammengestellt von Rudolf Naumann unter Mitarbeit von Max Steinecke, Helmut Friedrich, Alfred Albrecht und Werner Hessel, P. Schmalzried, Dr. Lutz Schmidt
Die Chronik von Pomßen, Gemeinde Parthenstein, Sachsen
Um 600 n. Chr. begannen die Sorben sich im Gebiet des heutigen Sachsen niederzulassen. Sie kamen vom Osten in die Bautzener Gegend und folgten dem Flusslauf der Elbe abwärts bis an die Saale und Mulde und diesen flussaufwärts.
Bei dieser Landnahme stießen sie auf wenig Widerstand, da viele ansässige Stämme bei der Völkerwanderung ihre Siedlungsräume verlassen hatten.
Namensgebungen der Sorben für ihre neuen Siedlungen entsprachen dem Namen des jeweiligen Anführers, später meist natürlichen Gegebenheiten, wie z. B. Oelzschau = Eulenort, Muckern = nasse Stelle, Oetzsch = Schaf.
Die Dörfer der Sorben besaßen meist die Form des Weilers – die Häuser waren um einen Teich angeordnet, und deren Giebel zeigten zum Teich. Es gab aber auch schon Burgen und Burgbezirke.
Pomßen wird als rein sorbische Siedlung zwischen 600 und 900 n. Chr. entstanden sein. Der Siedlungskern wird im Bereich des heutigen Brauteiches gelegen haben.
Anfang des 10. Jahrhunderts n. Chr. erfolgte unter König Heinrich I. die Eroberung der altsorbischen Gebiete zwischen Saale und Mulde und die Gründung des Bistums Merseburg (968 n. Chr.). In seiner 1012 bis 1018 n. Chr. geschriebenen Chronik umgrenzt Bischof Thietmar von Merseburg mit einer auf das Jahr 974 n. Chr. zurückdatierten Urkunde den zum Erzbistum Merseburg gehörenden großen Forst zwischen Saale und Mulde.
Es folgt eine Neuordnung und der Übergang zur deutschen Feudalherrschaft (Wiprechter und Wettiner), der im 12. Jahrhundert abgeschlossen war. Gleichzeitig erfolgte die Christianisierung des Gebietes. Es gab Burgwarthauptorte mit zugehörenden Siedlungen.
Die vom Norden eindringenden deutschen Siedler (Germanen, Sachsen) legten meist neue Siedlungen als Gassendörfer an und gaben diesen deutsche Namen, oder sie gaben ihrem Ort den Zusatz „Groß“ als Abgrenzung zur benachbarten sorbischen Siedlung.
Man geht davon aus, dass die Ansiedlung der germanischen Siedler meist ohne Verdrängung der sorbischen Siedler erfolgte. Im 12. Jahrhundert bildeten sich fest begrenzte Dorfmarken (das Land wurde den Orten fest zugeordnet) und damit Herrschaftsbereiche. Die adligen Lehnsherren errichteten Herrensitze, oft als Wasserburgen.
In den Dörfern entstanden Kirchen und es bildete sich ein Wegenetz. So kann man davon ausgehen, dass ein Weg vom ehemaligen Schloss Oberholz über Pomezin = Pomßen auf der Hohen Straße nach Grimma oder Großbardau führte.
Literatur
01 Steinecke, Max Das Hohe Lied der Heimat I., II., III., IV – Chronik Heimatverein
02 Günther, Klaus Wehrkirche Pomßen Sax-Verlag Beucha 1995
03 Sächsische Kirchengalerie Sachs. Staatsarchiv Leipzig
04 Neue Sächsische Kirchengalerie Sächs. Staatsarchiv Leipzig
05 Schirmer, Dr. Uwe Das Amt Grimma 1485-1548 Sax-Verlag Beucha 1996
06 Heydick, Lutz Rittergüter und Schlösser im Leipziger Land Sax-Verlag Beucha 1993
07 Held, Wieland 1547 Die Schlacht bei Mühlberg/Elbe Entscheidung auf dem … Sax-Verlag Beucha 1997
08 Gurlitt, Cornelius Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenk- C.C. Meinhold & Söhnemäler des Königreichs Sachsen, 19. Heft: HA Grimma 1897
09 Rüdiger,B./ Im Pleiße- und Göselland – Pro Leipzig e.V. 1999 Kretschmer K. Zur Geschichte einer Kulturlandschaft
10 Steinecke, Max 100 Jahre Schulhaus zu Pomßen 1859-1959 PGH Druck und Papier Grimma
11 Naunhofer Heimatblatt Juli 1926 Seite 27
12 Naunhofer Geschichte Sax-Verlag, Beucha 1998
13 Loose, Walter Naunhofer Heimatblatt Jan. 1927
14 Album der Rittergüter und Schlösser des Königreiches Sachsen Gustav Poenicke, Leipzig
15 Niemetz, Gustav Geschichte der Sachsen vom germanischen Stamm bis zum Oberlausitzer Verlag Freistaat
Entstehungszeit der Kirche
An Zeugen aus dieser Zeit sind uns die stattlichen Rundbogen, zwei Säulen mit Würfelkapitellen und der schwere unverzierte Taufstein aus Rochlitzer Porphyr erhalten. (02)
Es erfolgte die uns bekannte Ersterwähnung von Pomßen.
In diesem Jahr stellte der Edelfreie Siegfried von Mügeln zwei Urkunden aus, in denen er das von ihm gegründete Kloster Mariental bei Sornzig ausstattete. Unter den Zeugen auf einer dieser Urkunden (Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, O.U. 563b) befindet sich ein Friedrich von Pomßen
(Originalschreibweise: Frideric de Pomezin).
Ein Ritter Hermann von Pomezin wird erwähnt (01)
Feige von Pomßen wird als ein tapferer und mannhafter Ritter geschildert, der Schwert und Lanze ebenso rüstig zu schwingen verstand wie den gefüllten Becher. Als Ritter von echtem Schrot und Korn lebte er in unaufhörlicher Fehde mit seinen geistlichen Nachbarn, den Mönchen des Augustinerklosters zu Grimma, und es gehörte zu Ritter Feiges besonderen Genüssen, einen dieser Augustiner zu malträtieren. Auf der Wartburg zeigt man eine zentnerschwere eiserne Rüstung, welche einst Feige von Pomßens Eigentum war. (11)
Der Burggraf Otto von Leisnig ist Lehnsherr von Pomßen.
Er belehnt seinen Enkel, den Ritter Nickel. (01)
Der Burggraf Georg von Leisnig belehnt Nickel Pflugk mit Pomßen. Dessen Sohn Hans Pflugk I. (bis 1490), dessen Sohn Hans Pflugk II. (1490 bis 1520) und Moritz Pflugk (bis 1534) folgten. (01, 02, 03) (Siehe hierzu: Zeitzeugen und Legenden aus sieben Jahrhunderten Schuld und Sühne des Moritz Pflugk)
An der Parthe wird eine Wassermühle errichtet. Dazu wird die Parthe angestaut - unser Mühlteich entsteht.
Es brennt ein Kretzscham (Gasthof) nieder. Der Besitzer war nicht mehr in der Lage, seinen Kretzscham wieder aufzubauen. Nunmehr gibt es nur noch einen Kretzscham in Pomßen. (05)
Erste evangelische Kirchenvisitation in Pomßen (02)
Die hochverschuldeten Pflugke müssen Pomßen verkaufen. Käuferin ist Kunigunde, die Ehefrau des Nicolaus von Minkwitz. Es folgt Georg von Minkwitz als Inhaber des Rittersitzes Pomßen (01, 03)
Der Kursächsische Kammerherr, Hans von Ponickau geb. 1508 gest. 1573, kauft den Rittersitz Pomßen (01). Es folgen als Herren von Pomßen
Hans Georg von Ponickau geb. 1540 gest. 1613
Johann von Ponickau geb. 1584 gest. 1642
Johann Georg von Ponickau geb. 1605 gest. 1663
Johann Christoph I. von Ponickau geb. 1652 gest. 1726
Johann Christoph II von Ponickau geb. 1681 gest. 1727
Johann Christoph III von Ponickau geb. ? gest. 1780
(siehe hierzu: Die Herren von Schloss und Rittergut Pomßen)
Der Gastwirt Anthonius Krebs, Besitzer eines Pferdnergutes mit Erbschankrecht in Pomßen, ist einer der drei vermögendsten Personen auf dem Lande in der Amtshauptmannschaft Grimma. (05)
Hans von Ponickau baut auf der Stelle der ehemaligen Wasserburg das Schloss vom Grunde neu auf (Lehnsbrief 1611). Inschrift an der Wendeltreppe. (06)
Herzog Moritz zieht sich aus Leipzig über Pomßen nach Grimma zurück, nachdem er vorher die reichsten Bürger Leipzigs aufs Rathaus beordert hatte, um sie zur Abgabe ihrer Geldvermögen zu zwingen. Die Münzmengen ließ er auf Begleitwagen mitführen. (07)
Kurfürst August belehnt seinen Kammerherren, Hans von Ponickau, Amtshauptmann von Grimma und Leipzig, mit Pomßen, Seifertshain, Naunhof (nebst wüstem Schloss), Eicha, Albrechtshain, Erdmannshain, Fuchshain, Grethen, Klinga, Staudnitz, Threna, Wachau, Köhra, Bernbruch, Buch, Etzoldshain, Kleinbardau, Glasten, Ballendorf, Heuersdorf, Reichersdorf und Stockheim. (01)
Schaffung des Renaissance-Sandsteinaltares in der Kirche als Poni Kauische Stiftung. Er ersetzt den geschnitzten hölzernen gotischen Flügelaltar. (08)
Das vermutete Baujahr der ältesten Bauteile der Pomßener Orgel. (06)
Es herrschte die Ruhr, an welcher auch hier viele Kinder starben. (01)
Dreißigjähriger Krieg
Johann von Ponickau kauft das Rittergut in Belgershain
Andreas Syrbe von Schönbach, welcher in Grethen Feuer angelegt hatte, wodurch drei Bauernhöfe in Asche gelegt wurden, wird zu Pomßen mit dem Schwerte gerichtet. Der Körper ist auf dem Kirchhofe begraben worden. (01)
Pest im Ort in Pomßen sind 131 Personen begraben worden. 63 davon stammen aus Pomßen, die übrigen aus Großsteinberg und den umliegenden Ortschaften. (01)
Der Rat zu Leipzig soll sich im Jahre 1622 vom Rittergut Pomßen 500 Scheffel Korn geborgt haben, die er nicht bezahlen konnte. Dafür tritt er die beiden Dörfer Baalsdorf und Hirschfeld an den Reichspfennigmeister Johann von Ponickau auf Pomßen ab.
Plünderung im Ort durch die Schweden. (siehe 17. Jahrhundert - Pomßen im Dreißigjährigen Kriege)
Es hat ein heftiger Sturm nach gehaltener Communion den Kirchturm umgeworfen und die Orgel zerstört. (01)
„Hat des Edelmanns Knecht von Polenz, den 22. Februar einen Einwohner allhier, Peter Dögeln, da er in seinem Hause allein gewesen, erschlagen. Der Mörder wurde den 22. April 1661 gefänglich zu Pomßen eingebracht und den 2. Mai gerädert." (01)
Kirche erhält eine Glockenstube mit Rundbogenfenstern und einen Dachreiter mit Haube. (02, 08)
Einbau der Nordempore und ggf. der Kassettendecke in der Kirche. (08)
Aufstellung der Renaissance-Orgel durch den Döbelner Orgelbau Meister Gottfried Richter in der Kirche. (01)
„Dom.l4.p.Trin. ist die Kirche allhier bestohlen und die Kelch und Meßgewandt, dem Gold, so im Kasten gewesen, beraubet gefunden worden und hat man den Thäter nicht erforschen können." (01)
Der Patronatsherr Johann Christoph von Ponickau und seine Gattin Anna Elisabeth geborene Wetzlarin von Marsilien schenkten der Kirche ein prachtvolles Geläut. Bei der schlechten Beschaffenheit der Straßen und der Beförderungsmittel zog es der Glockengießer, Meister Johann Jacob Hoffmann aus Halle, vor, die drei Glocken auf dem Friedhöfe zu gießen. Die große Glocke wiegt 15 72 Ztr. und 7 Pfund. Am grünen Donnerstag wurde die Glocke zum ersten Mal geläutet. Sie hat den Ton F. Die kleine Glocke ist am 8. Mai ganz neu gegossen worden und hat den Ton D. Das Gewicht derselben stellt sich auf 3 Ztr. und einige Pfund. Die Mittelglocke ist am 29. Juli gegossen worden und wiegt 7 Ztr. weniger 8 Pfund. Auch der Glockenstuhl wurde vollständig erneuert. (01)
Einbau der zweigeschossigen Herrschaftskapelle in der Kirche. Dabei wurde die Nordmauer des hohen Chores durchbrochen.
Zu Ostern verehrte des Stiftshauptmanns Schwester (?), Fräulein Simphoria Wetzlarin von Marsilien, der Kirche ein neues Taufbecken nebst Kanne und Almosen. (01)
Es sind Gottfried Winklern allhier von seiner Ehefrau Zwillinge totgeboren worden, und zwar zwei Töchter, die nur einen Leib, aber zwei Köpfe, vier Arme und vier Füße hatten. (01)
Dem Pomßener Gut waren 326 Bauern und Gärtner sowie 86 Häusler untertänig. (06).
Der Landvermesser Zümer setzt in Pomßen einen Viertelmeilenstein. (Seite 61)
Es brannte der Schloßturm ab. (01) Erneuerung des Turmes und Einbau einer Glocke von 1671. (07)
Es herrschte hier und in der Umgebung ein ungemein heftiger Sturm, der viel Schaden verursachte. (01)
Am 4. Advent brannte der hiesige Gasthof infolge einer böswilligen Brandstiftung vollständig nieder. (01)
Die Kirchenuhr wurde vom Dessauer Hofuhrmacher Christian Müller gebaut. 1934 nach der Urfassung erneuert. (01)
Es kam ein so heftiges Ungewitter, welches mit Hagel und Schloßen begleitet war, so dass nicht nur die hiesigen Feldfrüchte, die man eben ernten wollte, sondern auch das Wild vernichtet wurde. (01)
Siebenjähriger Krieg
Gleich nach dem Tag nach Maria Heimsuchung kam ein Freibataillon, welches sich Volontairs d ' ostfrise nannte, nach Pomßen, lag drei Tage hier, machte großen Unfug, unser Gotteshaus und Kirchhof mußte zu ihrer Wachstube dienen. (01)
„Am 15. Februar wurde zu Hubertusburg Frieden zwischen Sachsen und Preußen geschlossen. Den 20. März darauf wurde ein allgemeines Dankfest wegen des erlangten edlen Landfriedens angestellt. Die Texte, die an diesem Tage von hoher Obrigkeit vorgeschrieben wurden, waren in der Frühpredigt Ps. 28, 6-9, in der Nachmittagspredigt Jes. VI. 1. Da wir schuldig waren, unserem Gott auch äußerlich Dankbarkeit zu bringen, so habe ich folgende Anordnung gemacht.
- Um 9 Uhr mußte sich die ganze Gemeinde, alle in schwarzem Kleide, versammeln. Die Jungfrauen aber und die Schulmädchen trugen Kränze auf ihren Häuptern.
- Da zum Gottesdienst war eingeläutet, so verfügte ich mich mit dem hochadeligen Herrn Gerichtsschöppen Conradi und Schulmeister Kästner zu der bei dem Gemeindehause versammelten Gemeinde.
- Sobald wir daselbst angekommen waren, wurde das Lied unter Lautung der Glocken und einstimmenden Trompeten und Pauken: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, angestimmt. Als die zwei ersten Verse ausgesungen waren, wurde in folgender Anordnung unter Absingen des angefangenen Liedes und Lauten der Glocken gezogen:
- a. die Schulmägdlein 2 und 2 in Kränzen
- b. die Schulknaben 2 und 2
- c. die Jungfrauen 2 und 2
- d. die jungen Burschen
- e. die Trompeten und Pauken
- f. der hochadel. Gerichtsschöppe, welcher von dem Pastor und dem Schulmeister geführt wurde.
- g. der Richter, welchem die beiden Kirchväter Gottfried Papsdorf und Gottlieb Götze folgten
- h. die Gerichtsschöppen 2 und 2
- i. die übrigen Männer nach ihrer Ordnung
- j. die Weiber 2 und 2
sobald man in der Kirche angekommen war, gingen die Schulmägdlein auf den Chor bei den herrschaftlichen Betstüblein gesetzten Bänke, die Jungfrauen auf die ersten Weiberstühle, davon waren gleich 40 an der Zahl, die Schulknaben auf die bei der Sakristei gesetzten Bänke. Die jungen Burschen auf ihre Emporkirche, die Männer auf ihre Stühle und die Weiber auf die übrigen Stühle und Bänke."
Der Schnee lag über zwei Ellen hoch. Er verzehrte das Getreide auf den Fluren. Es war eine sehr schlechte Ernte. Die Hungersnot hielt zwei Jahre an. Ein Scheffel Korn kostete 8-10 Thaler. (01)
Die Orgel wird repariert, ein neues Clavier und Pedal eingebaut, durch H. Göttlich, Universitäts-Orgelbauer zu Leipzig. 50 Thaler (01)
Johann Christoph III von Ponickau verkauft das Rittergut an Andreas Ludwig. (01)
„... starb an einem unglücklichen Falle vom Wagen Johann Christoph, Johann Christian Haferkorns, Gast- und Schenkwirths allhier, ältester Sohn (9 Jahre alt), da der ganze Wagen über ihn ergangen war. ..." (Kirchenbuch Pomßen) Der Grabstein befindet sich auf dem Pomßener Friedhof. (Seite 61)
Kauft Carl Sigismund Emilius von Uechteritz das Rittergut Pomßen (03)
Durch die aufziehenden Soldaten vor und die verletzten Soldaten nach der Völkerschlacht bei Leipzig entsteht viel Hunger und Not.
Sequestration des Rittergutes (03)
Der Cammer-Commissionsrathe Johann Gottfried Dietze erwirbt für 237 000 Thlr. das Rittergut Pomßen. (03) Das Schloß ist zu diesem Zeitpunkt nicht bewohnt und zum größten Teil von Wasser umgeben.
Umgestaltung der Schlossfassade im englischen Landhausstil - dem Tudorstil.
Pomßen wurde als Postanstalt für Naunhof zuständig. Zweimal in der Woche wurde die Post von Pomßen nach Naunhof zugestellt. Pomßen wurde Postanstalt für Belgershain und viele kleinere Orte (13).
Verfassungsgebung in Sachsen
Gesetz über Ablösungen und Gemeinschaftsteilungen zur Reform der Agrarverhältnisse. (09)
Einführung eines neuen Grundsteuersystemes, das die Steuerbefreiung des Adels aufhob, und der Schulpflicht in Sachsen. (09)
„Im Dorfe befindet sich ein Rittergut mit dazu gehöriger Schäferei und einer Wind- und einer Wassermühle; eine Kirche, Pfarre und Schule, ein Gasthof und eine Feldmeisterei, 8 Pferdnergüter, 17 Hintersässergüter, 13 Gärtnergüter, 2 Häusler mit Grundstücken, 1 Schmiede und 48 Häuslernahrungen, ein Gemeindehaus mit Bäckerei, 1 Armenhospital und die Bewohner belaufen sich auf 653 Seelen." Es gibt 131 Schulkinder, 58 Knaben und 73 Mädchen. (03)
Im Rittergut wurde die Brennerei errichtet, die bis 1947 arbeitete. Im zweitgrößten Betrieb in Sachsen (mit Fuchshain und Eicha) wurden jährlich jeweils von Oktober bis Mai 142 500 Liter Spiritus aus Kartoffeln gebrannt. Mit dem Abfallprodukt, der Schlempe, konnte im Winter das Rittergutsvieh gut gefüttert werden. (01)
Dem Schloss wird ein Pavillon vorgelagert. Die Reste des alten Wallgrabens zwischen Schloss und Verwaltungsgebäude wurden zugeschüttet. Zu diesem Zwecke wurden viele tausend Fuder Erde von den Rittergutsfeldern hinter der Schäferei angefahren. Von den Feldern bis zum Schloss war eigens dazu eine Feldbahn angelegt worden.
Ablösung der Patrimonialgerichtsbarkeit, die bis dahin von der Rittergutsherrschaft ausgeübt wurde. (09)
Der Schulvorstand entschied sich auf Drängen der Schulinspektion Grimma zu einem Neubau und dazu, das alte Schulgebäude abzureißen. (10)
Grundsteinlegung für die neue Schule. (10)
Einweihung des neuen Schulgebäudes (heutiger rechter Teil des Schulhauses) (10) (siehe: 19. Jahrhundert - Vertragsgestaltung beim Bau des 1859 eingeweihten neuen Schulgebäudes)
Die 1. Feuerlöschordnung für das Dorf Pomßen wird erlassen.
Gasthof „Zum Schwan" gebaut durch den Bauerngutsbesitzer Haferkorn. Der Gastwirt der Bauernhof-Gastwirtschaft in der Pomßener Hauptstraße (heute im Besitz von Fam. Kötz) hat auf seinem Grund ein neues Gasthofgebäude mit großem Hof, Stallungen, Scheunen, Schuppen und einer Kegelbahn neu erbaut und diesem auch einen großen Garten zugeteilt.
Wird Fritz Köhler Pächter des Gasthofes „Zum Schwan", der diesen danach kauft.
Bau des heutigen Kindergarten- und Hortgebäudes als Lazarett durch J.G. Dietze, später als Forsthaus des Rittergutes genutzt.
Pomßen hat über 800 Einwohner (AH Grimma 1060, S. 9)
Es erfolgte die Grundsteinlegung für die zweite Schule, die westlich vom vorhandenen Schulhaus und in gleicher Front mit ihm errichtet werden sollte. (10)
Einweihung des zweiten Schulhauses (heutiger linker Teil). (10)
Teilweise Schulgeldbefreiung für Kinder der höheren Rittergutsbeamten, „die innerhalb der derzeitigen Rittergutsgebäude wohnen". (10)
Der Kaufmann Karl Gottlieb Weiß aus Leipzig kauft das Rittergut.(04) Einführung des Turnunterrichtes an der Schule. (10)
Einführung des Nadelarbeitsunterrichtes an der Schule. (10) Gründung des Turnvereins 1886 Pomßen
Franz Wetzold kauft den Gasthof „Zum Schwan"
Renovierung der Kirche
Die Kirche wird abgeputzt und z.T. neu bedacht. Der Turmkopf wird mit entsprechender Urkunde versehen. Die Pfarrwirtschaftsgebäude werden mit Schiefer gedeckt (vorher Stroh). Ein völlig baufälliger Kuhstall wird abgebrochen. (01)
Fürst Otto Friedrich von Schönburg-Waldenburg kauft Schloss und Rittergut Pomßen.
Gründung des Militärvereins Pomßen (dieser hat 1925 60 Mitglieder - Vorsitzender: Max Ziegner) - davor bestand ein „Kriegerverein Pomßen und Umgebung" - jeden 2. September im Jahr wurde zur Erinnerung an die Schlacht bei Sedan 1870 ein großes Fest gefeiert.
Das Postamt wird nach 35jährigem Bestehen aufgehoben und in eine Postagentur umgewandelt. In diesem Jahr herrscht große Trockenheit und Hitze.
Während des Erntedankfestes wird ein neues Gottesackertor der Gemeinde übergeben. (01)
Das Rittergut wechselt in den Besitz von Fürst Victor von Schönburg- Waldenburg, Leutnant ä la suite der Kgl.-Preußischen Leib-Garde-Husaren. (01)
Die Ponickausche Begräbnisstätte unter der Kirche wird zwecks Reinigung geöffnet. (01)
Pomßen hat 749 Einwohner. (04)
Erntedankfest für eine so reiche Ernte, wie sie in den letzten Jahren nicht da war. (01)
Fahnenweihe des Kranken-Unterstützungs-Vereins Pomßen
Pomßen bekommt Elektrizität
1. Weltkrieg
Pomßen hat 790 Einwohner (AH Grimma, 1060, S. 177)
Überfall auf Pomßen durch ca. 40 Spartakisten aus Leipzig.
Verbindung der beiden Schulgebäude durch einen Verbindungsbau. (01)
Das Dorf erhält eine Ortsbeleuchtung (19 Straßenlampen)
Gründung des Fahrradvereins „Saxonia" Pomßen
Die Siedlung ostwärts der Kirche entsteht.
Sängerfest des Parthegaues. 22 Vereine treffen sich in Pomßen. (01)
Reiterfest auf den Parthewiesen. (01)
Die Brücke in der Kurve vor der Kirche und der Fleischerei Thormeyer wurde weggerissen, weil die Seitenmauern die Straße mit ihrem sehr starken Verkehr zu sehr beengten. Das Wasser von Schönfelds Teich und dem Brauteich wurde in Rohren entlang der Kurzen Straße bis zum ehemaligen Nöhringschen Gut geführt. (01)
Ein Sportplatz wurde gegenüber dem heutigen Kindergartengebäude für die Schule und die beiden Sportvereine, DT 1886 und Arbeiter-Turn-Verein Pomßen, angelegt. (01)
Einweihung der Turnhalle neben dem Gasthaus „Zum Goldbrunnen".
Erneuerung des Kirchturmes. (01)
Innenrenovierung der Kirche (02)
Zur Regelung der Parthe in der Flur Pomßen wurde oberhalb der Parthe ein Flutgraben (Vorfluter) gebaut und die anliegenden Wiesen drainiert.
Die Maul- und Klauenseuche tritt auf. Die Sperre des Ortes wird am 05.02.1938 aufgehoben (01).
Volkszählung - Pomßen hat 973 Einwohner. Dabei sind aber die Flugplatzarbeiter (98) und die ital. Landarbeiter (10 - Rittergut) mitgezählt.
2. Weltkrieg
Bei der Viehzählung wurden in Pomßen ermittelt: 100 Pferde, 455 Kühe, 979 Schweine, 557 Schafe, 73 Ziegen, 2251 Hühner, 418 Gänse, 132 Enten, 45 Truthühner und 55 Bienenvölker.
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Pomßen.
Wehrleiter:
1940 bis 1946 Weidner, Anton
1946 bis 1978 Albrecht, Alfred
1979 bis 1987 Schöne, Hanno
1987 bis 1990 Schöne, Horst
1991 bis 1997 Gelfert, Siegfried
1997 bis Kretzschmar, Wolfgang
Bombenabwürfe auf Pomßen (siehe 20. Jahrhundert - Der Bombenangriff auf Pomßen am 20.10.1943)
Amerikanische Soldaten besetzen das Gebiet bis Grimma. (siehe 20. Jahrhundert - Iwan Hofmann berichtet über die letzten Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner in Pomßen am 16.04.1945)
Bodenreform
Ein Sturm bringt das Windrad (pumpte Wasser aus dem Rittergutsbrunnen), das hinter der Schäferei stand, zum Einsturz.
Datum nicht bekannt: Frau Anita Steinbach (Schöne) holt die große und die kleine Kirchenglocke, die in den letzten Kriegsjahren zur Metallgewinnung demontiert wurden, vom Bahnhof Kössern nach Pomßen zurück.
Eröffnung des Kinderheimes
Das Kinderkurheim erhält den Namen „Dr. Margarethe Blank" Vorrangig werden für jeweils ca. 60 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren prophylaktische Kuren durchgeführt.
Gründung der Landwirtschaftlichen Produktions-Genossenschaft Typ I „Clara Zetkin" Vorsitzender: Mätzold, Oswin
Erste Scherbenfunde eines Gräberfeldes aus der Bronzezeit (Lausitzer Kultur) am Fuchsberg durch den Lindhardter Schüler Peter Fuhrmann. Grabungen erfolgten für 38 Gräber bis 1964.
Umwandlung in LPG Typ III „Clara Zetkin" Vorsitzende:
1953 bis 1961 Mätzold, Oswin
1962 bis 1963 Hempel, Horst
1964 bis 1968 Lindner, Alex
1969 bis 1970 Hennig, Willi
1971 bis 1972 Sieber, Klaus
Zwischen Pomßen und Köhra wird am Fuchsberg ein Waldschutzstreifen angelegt.
Gründung der Kleingartensparte Pomßen des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter Vorsitzende: Hentschel; Rolle, Günter; Hnat, Walter; Frühauf, Heinz; Peper, Lutz
Die Lebensmittelkarten werden abgeschafft
Gründung der LPG Typ I „Vorwärts" Vorsitzender: Köcher, Franz
Die Feldscheune brennt ab.
Aufnahme des 1967 gegründeten Chores mit Gitarrengruppe in den Verein der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter Pomßen. Chorleiter: Karl Schäfer, Erika Starke, Manfred Görl, Jürgen Hartmann, Ingrid Fischer
Zusammenschluß der LPG Typ III „Clara Zetkin" und der LPG Typ I „Vorwärts" zur LPG Typ III „Clara Zetkin"
Vorsitzende: 1973 bis 1975 Köcher, Franz
1976 bis 1991 Sandmann, Werner
Gründung der Kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion Threna, Sitz Köhra, für den Feldbau. Der Obstbau blieb in Pomßen.
Erste Funde am Gräberfeld der Bronzezeit am Mühlteich. Es folgen Grabungen bis 1981.
Die LPG-Scheune brennt infolge Brandstiftung ab.
Neueindeckung des Kirchturmes und Außenrenovierung der Kirche.
Gründung der LPG Pflanzenproduktion Threna
Pomßen hat 730 Einwohner (Rundblick)
Renovierung des Kindererholungsheimes innen und außen
Pomßen hat 900 Einwohner - PLZ 7271
Das letzte von mindestens 33 Strandfesten findet unter Regie des Kleingartenvereines am Mühlteich statt.
Beginn der Innenrenovierung der Kirche
Umwandlungsversammlung zur Gründung der Pomßener Agrargenossenschaft e. G. Vorstandsvorsitzender: Sandmann, Werner
Der Schulunterricht in Pomßen wird eingestellt.